Quentin Tarantino: Es war einmal in Hollywood - Buchkritik
Tilman Rau • 27. Juli 2022
Mehr als das Buch zum Film

Manchmal geschehen merkwürdige Dinge auf dem Buchmarkt. Man denke nur an die unsägliche Reihe „Das magische Auge“, an der man zu einer gewissen Zeit schlicht nicht vorbeikam. Das waren diese Bilder, die lediglich aus bunten und völlig sinnlosen Strukturen bestanden. Wenn man sie aber lange genug anstarrte, verwandelten sie sich in räumliche Darstellungen von Schiffen, Pokalen, Planeten und Nilpferden. Diese Drei Deh-Objekte waren zwar genauso sinnlos wie die Muster, in denen sie sich versteckten, aber immerhin konnte man „Ich seh’s“ schreien, wenn man sie vor Augen hatte.
Mindestens genauso verrückt und sinnlos war eine Büchermode, die Anfang bis Mitte der 80er Jahre ihren Höheunkt erreichte: Das Buch zum Film. Wohlgemerkt ZUM Film. Also nicht eine Romanvorlage wie Buddenbrooks oder Alice im Wunderland. Sondern ein Buch, das die Handlung des Filmes noch einmal nacherzählt. Ein ganzes Heer von erfolglosen Autoren muss damals damit beschäftigt gewesen sein, 90-Minuten-Filme in zweihundertseitige Pseudo-Romane zu verwandeln. Wenn es eine Sache gibt, die für einen Autor noch unbefriedigender sein muss als ein Roman, den niemand liest, dann ist es sicherlich ein Roman, dessen Geschichte alle Leser schon kennen. Denn ein Buch zum Film liest man, wenn man den Film gesehen und gemocht hat, nicht statt sich den Film anzusehen.
Ich bin mit diesen Büchern aufgewachsen, hatte E.T. der Ausserirdische und seine Abenteur auf der Erde von William Kotzwinkle ebenso im Regal stehen wie Der City Hai von Walter Wager. Noch heute überkommt mich ein Gefühl irgendwo zwischen Scham und wohligem Kribbeln, wenn ich an diese Filmroman-Bändchen denke, die gerne bei Heyne oder Bastei Lübbe erschienen und als kleinen Bonus neben dem reinen Text auch einige Seiten mit Fotos aus dem Film enthielten.
Es ist nicht so, dass ich sofort an diese dünnen Taschenbücher dachte, als ich in einem Buchladen zum ersten Mal eine Ausgabe von Es war einmal in Hollywood von Quentin Tarantino liegen sah. Dazu gab es zu viele Unterscheidungsmerkmale:
- Der Name des Autors ist identisch mit dem Namen des Regisseurs.
- Es handelt(e) sich um ein gebundenes Buch.
Und am wichtigsten:
- Es kostete 25 Euro, was in der Sprache der 80er Jahre so viel heißt wie: 50 Mark!
Bei einem so teuren und überdies schön gestalteten Buch sollte man doch davon ausgehen, mehr Inhalt vorzufinden als nur eine bloße Nacherzählung eines Filmes, und mag es auch ein so guter sein wie der (zumindest im Original) namensgleiche Tarantino-Streifen aus dem Jahr 2019, der bei zehn Nominierungen auch mehr als die letztlich zwei ergatterten Oscars verdient gehabt hätte.
Aber! Und jetzt kommt das Aber! Auf dem Rücken des Romans sind neben der üblichen albernen Marketing-Lobhudelei („Der erste Roman von einem der begnadetsten Geschichtenerzähler unserer Zeit“) auch ein paar Namen zu lesen: Rick Dalton. Cliff Booth. Sharon Tate. Charles Manson.
Und das sind dann eben doch wieder einige der Haupt-Charaktere des Films.
Also doch nur ein Papierabklatsch der von der Leinwand bekannten Geschichte?
Ich kann’s kurz machen: Nein. Dieses Buch ist mehr. Und anders. Anders gut. Anders sehr gut.
Die grundlegende Geschichte ist ähnlich: Wir befinden uns im Hollywood der späten 60er Jahre. Rick Dalton, ein Schauspieler, der seine besten Jahre hinter sich hat, ist auf der Suche nach neuen Engagements und muss sich damit begnügen, den Schurken zu geben, an dem sich – erfolgreichere – Helden abarbeiten können. Rick wird herumkutschiert von seinem Stunt-Double Cliff Booth, einem ehemaligen Kriegshelden, der immer noch gut mit Fäusten und Waffen umgehen kann und einen Schlag bei den Frauen hat, den er auch weidlich ausnutzt. In diesem Hollywood, im weiteren und näheren Umkreis dieser beiden Herren, schwirren noch eine ganze Menge weiterer Gestalten herum: Roman Polanski, Sharon Tate, Candice Bergen, Charles Manson, George Spahn sowie das Hippie-Mädchen Pussycat. Und viele mehr. In diesem Universum von Charakteren dreht immer irgendjemand einen Film mit irgendjemandem, hat schon mal einen Film mit irgendjemandem gedreht oder wird dies noch tun. Jemand hat Sex mit jemandem, hatte mal Sex oder wird mal Sex haben. Irgendjemand will immer berühmt werden oder wollte es mal, jemand braucht Geld oder hat viel davon. Jemand trinkt einen über den Durst und jemand prügelt sich.
In diesem Universum lässt Tarantino seine Protagonisten herumspazieren und plaudert, wenn er nicht gerade an so etwas wie einer Handlung strickt, über dieses unüberschaubare Netz aus Querverbindungen. Der Roman besteht in Teilen aus seitenlangen Beschreibungen und Aufzählungen, wer mit wem wann welchen Film gedreht hat. Das kommt einem manchmal so vor wie diejenigen Teile der Bibel, in denen es um die Genealogie des Volkes Israel und seiner Geschlechter und Könige geht. In dem Moment, in dem man’s liest, ist es auch schon wieder aus dem Gehirn verschwunden.
Quentin Tarantino ist sich dessen natürlich bewusst und hat lesbaren Spaß daran, seine Leser mit vielen unbrauchbaren Infos zuzuballern. Der Spaß beruht aber auf Gegenseitigkeit, weil dieses Kuddelmuddel aus Verflechtungen einfach so frech, flapsig und flegelhaft erzählt wird. Außerdem schimmert auch immer noch so etwas wie eine Story durch, die zwar niemals konsequent zu Ende erzählt wird, die aber trotzdem niemals in der Spannung nachlässt.
Es sei an dieser Stelle verraten, dass Tarantino seinen ersten Roman nicht in dem blutrünstigen Massaker enden lässt, in das seine Filme meistens nach der Hälfte bis zwei Dritteln münden.
Hier muss sich niemand vor Blut fürchten, höchstens Bruce Lee. Er hat ja auch im Film einen kleinen – wenig schmeichelhaften – Auftritt. Wie so einiges aus dem Film wird auch hier die Background-Story, die sich vielleicht besser mit Worten als mit Bildern erklären lässt, ein wenig breiter ausgetreten. Bevor Stuntman Cliff Booth seine Faust in Bruce Lees Gesicht versenkt, darf er Lee, den er im Übrigen eher als Tänzer denn als Kämpfer sieht, eine kleine Verballektion erteilen, indem er ihm erklärt, was er von seiner Schlagkraft hält: „Backe, backe Kuchen im Schnelldurchlauf ist immer noch Backe, backe Kuchen.“
Bei der Lektüre dieses Romans darf herzhaft gelacht werden. Wer auf coole Typen mit losem Mundwerk, zünftige Sprüche und politisch unkorrekte Zoten steht, wird ordentlich was zu kichern haben.
Wie gesagt, diese Hollywood-Geschichte, die das Märchenhafte bereits im Namen trägt, endet nicht mit einem Gemetzel. Dafür mit einem ebenso unspektakulären wie locker hingepfiffenen Satz, der sich wie eine Verbeugung vor dem Schlusssatz von der Hörspielversion von Erich Kästners Der 35. Mai liest und der, so viel sei hier versprochen, keine Spoiler-Sprengkraft besitzt: „Und am nächsten Tag auf dem Studiogelände der Twentieth Century Fox, am Set von Lancer, hauten die beiden Schauspieler alle aus den Socken.“
Mindestens genauso verrückt und sinnlos war eine Büchermode, die Anfang bis Mitte der 80er Jahre ihren Höheunkt erreichte: Das Buch zum Film. Wohlgemerkt ZUM Film. Also nicht eine Romanvorlage wie Buddenbrooks oder Alice im Wunderland. Sondern ein Buch, das die Handlung des Filmes noch einmal nacherzählt. Ein ganzes Heer von erfolglosen Autoren muss damals damit beschäftigt gewesen sein, 90-Minuten-Filme in zweihundertseitige Pseudo-Romane zu verwandeln. Wenn es eine Sache gibt, die für einen Autor noch unbefriedigender sein muss als ein Roman, den niemand liest, dann ist es sicherlich ein Roman, dessen Geschichte alle Leser schon kennen. Denn ein Buch zum Film liest man, wenn man den Film gesehen und gemocht hat, nicht statt sich den Film anzusehen.
Ich bin mit diesen Büchern aufgewachsen, hatte E.T. der Ausserirdische und seine Abenteur auf der Erde von William Kotzwinkle ebenso im Regal stehen wie Der City Hai von Walter Wager. Noch heute überkommt mich ein Gefühl irgendwo zwischen Scham und wohligem Kribbeln, wenn ich an diese Filmroman-Bändchen denke, die gerne bei Heyne oder Bastei Lübbe erschienen und als kleinen Bonus neben dem reinen Text auch einige Seiten mit Fotos aus dem Film enthielten.
Es ist nicht so, dass ich sofort an diese dünnen Taschenbücher dachte, als ich in einem Buchladen zum ersten Mal eine Ausgabe von Es war einmal in Hollywood von Quentin Tarantino liegen sah. Dazu gab es zu viele Unterscheidungsmerkmale:
- Der Name des Autors ist identisch mit dem Namen des Regisseurs.
- Es handelt(e) sich um ein gebundenes Buch.
Und am wichtigsten:
- Es kostete 25 Euro, was in der Sprache der 80er Jahre so viel heißt wie: 50 Mark!
Bei einem so teuren und überdies schön gestalteten Buch sollte man doch davon ausgehen, mehr Inhalt vorzufinden als nur eine bloße Nacherzählung eines Filmes, und mag es auch ein so guter sein wie der (zumindest im Original) namensgleiche Tarantino-Streifen aus dem Jahr 2019, der bei zehn Nominierungen auch mehr als die letztlich zwei ergatterten Oscars verdient gehabt hätte.
Aber! Und jetzt kommt das Aber! Auf dem Rücken des Romans sind neben der üblichen albernen Marketing-Lobhudelei („Der erste Roman von einem der begnadetsten Geschichtenerzähler unserer Zeit“) auch ein paar Namen zu lesen: Rick Dalton. Cliff Booth. Sharon Tate. Charles Manson.
Und das sind dann eben doch wieder einige der Haupt-Charaktere des Films.
Also doch nur ein Papierabklatsch der von der Leinwand bekannten Geschichte?
Ich kann’s kurz machen: Nein. Dieses Buch ist mehr. Und anders. Anders gut. Anders sehr gut.
Die grundlegende Geschichte ist ähnlich: Wir befinden uns im Hollywood der späten 60er Jahre. Rick Dalton, ein Schauspieler, der seine besten Jahre hinter sich hat, ist auf der Suche nach neuen Engagements und muss sich damit begnügen, den Schurken zu geben, an dem sich – erfolgreichere – Helden abarbeiten können. Rick wird herumkutschiert von seinem Stunt-Double Cliff Booth, einem ehemaligen Kriegshelden, der immer noch gut mit Fäusten und Waffen umgehen kann und einen Schlag bei den Frauen hat, den er auch weidlich ausnutzt. In diesem Hollywood, im weiteren und näheren Umkreis dieser beiden Herren, schwirren noch eine ganze Menge weiterer Gestalten herum: Roman Polanski, Sharon Tate, Candice Bergen, Charles Manson, George Spahn sowie das Hippie-Mädchen Pussycat. Und viele mehr. In diesem Universum von Charakteren dreht immer irgendjemand einen Film mit irgendjemandem, hat schon mal einen Film mit irgendjemandem gedreht oder wird dies noch tun. Jemand hat Sex mit jemandem, hatte mal Sex oder wird mal Sex haben. Irgendjemand will immer berühmt werden oder wollte es mal, jemand braucht Geld oder hat viel davon. Jemand trinkt einen über den Durst und jemand prügelt sich.
In diesem Universum lässt Tarantino seine Protagonisten herumspazieren und plaudert, wenn er nicht gerade an so etwas wie einer Handlung strickt, über dieses unüberschaubare Netz aus Querverbindungen. Der Roman besteht in Teilen aus seitenlangen Beschreibungen und Aufzählungen, wer mit wem wann welchen Film gedreht hat. Das kommt einem manchmal so vor wie diejenigen Teile der Bibel, in denen es um die Genealogie des Volkes Israel und seiner Geschlechter und Könige geht. In dem Moment, in dem man’s liest, ist es auch schon wieder aus dem Gehirn verschwunden.
Quentin Tarantino ist sich dessen natürlich bewusst und hat lesbaren Spaß daran, seine Leser mit vielen unbrauchbaren Infos zuzuballern. Der Spaß beruht aber auf Gegenseitigkeit, weil dieses Kuddelmuddel aus Verflechtungen einfach so frech, flapsig und flegelhaft erzählt wird. Außerdem schimmert auch immer noch so etwas wie eine Story durch, die zwar niemals konsequent zu Ende erzählt wird, die aber trotzdem niemals in der Spannung nachlässt.
Es sei an dieser Stelle verraten, dass Tarantino seinen ersten Roman nicht in dem blutrünstigen Massaker enden lässt, in das seine Filme meistens nach der Hälfte bis zwei Dritteln münden.
Hier muss sich niemand vor Blut fürchten, höchstens Bruce Lee. Er hat ja auch im Film einen kleinen – wenig schmeichelhaften – Auftritt. Wie so einiges aus dem Film wird auch hier die Background-Story, die sich vielleicht besser mit Worten als mit Bildern erklären lässt, ein wenig breiter ausgetreten. Bevor Stuntman Cliff Booth seine Faust in Bruce Lees Gesicht versenkt, darf er Lee, den er im Übrigen eher als Tänzer denn als Kämpfer sieht, eine kleine Verballektion erteilen, indem er ihm erklärt, was er von seiner Schlagkraft hält: „Backe, backe Kuchen im Schnelldurchlauf ist immer noch Backe, backe Kuchen.“
Bei der Lektüre dieses Romans darf herzhaft gelacht werden. Wer auf coole Typen mit losem Mundwerk, zünftige Sprüche und politisch unkorrekte Zoten steht, wird ordentlich was zu kichern haben.
Wie gesagt, diese Hollywood-Geschichte, die das Märchenhafte bereits im Namen trägt, endet nicht mit einem Gemetzel. Dafür mit einem ebenso unspektakulären wie locker hingepfiffenen Satz, der sich wie eine Verbeugung vor dem Schlusssatz von der Hörspielversion von Erich Kästners Der 35. Mai liest und der, so viel sei hier versprochen, keine Spoiler-Sprengkraft besitzt: „Und am nächsten Tag auf dem Studiogelände der Twentieth Century Fox, am Set von Lancer, hauten die beiden Schauspieler alle aus den Socken.“

Es ist Fototag in der Highschool. An diesem Tag werden Portraitbilder von allen Schülern geschossen – die kommen dann ins Jahrbuch. Ist ja klar, dass ein solcher Tag einen gewissen logistischen Aufwand bedeutet. Um sicherzustellen, dass auch wirklich niemand vergisst, sich rechtzeitig – und vor allem ordentlich gekämmt – in der Turnhalle einzufinden, hat der Fotograf ein paar Assistentinnen mitgebracht. Eine dieser Assistentinnen ist die 25-jährige Alana Kane (Alana Haim). Alana hat ihren Platz im Leben und ihren Weg noch nicht gefunden und sieht den Job als Wartebank, bis ihr eines Tages eine bessere Idee kommt. In diesem Moment läuft ihr Gary Valentine (Cooper Hoffman) über den Weg. Er ist alles, was Alana nicht ist: Erfolgreich, extrovertiert, zielstrebig. In seinem jungen Alter kann er bereits auf so etwas wie eine berufliche Laufbahn zurückblicken. Außerdem weiß er, was er will. Jedenfalls für den jeweiligen Moment. Und: Gary ist 15 und einer der Highschool-Schüler, die aufs Foto sollen. Licorice Pizza läuft noch keine 5 Minuten, da hat sich Gary in Alana verliebt, sie im Vorübergehen am Arm gepackt und zum Abendessen eingeladen. „Aber erst, wenn ich meinen kleinen Bruder ins Bett gebracht habe. Er ist 8. Fast 9.“ An dieser Stelle müsste der Film eigentlich vorbei sein. Denn welche Geschichte sollte er fürderhin erzählen? Die eines liebestollen Teenagers, der jede Nacht scharrend und sabbernd vor dem Haus einer jungen Frau erscheint und ihr im Laufe von 130 Minuten das Holz der Haustür zerkratzt? Oder alternativ eine seicht-lüsterne Lolito-Schmonzette, die sich darin badet, ein Tabu zu brechen? Paul Thomas Anderson, der sowohl Regie geführt als auch das Drehbuch geschrieben hat, entscheidet sich weder für das eine noch für das andere. Stattdessen lässt er eine Liebesgeschichte auf seine Zuschauer los, die im Kino der letzten Jahre ihresgleichen sucht. Eine Liebesgeschichte voller Unmöglichkeit und voller Unausweichlichkeit, voller Verlangen und voller Zurückweisung, voller Begierde und voller Keuschheit, voller Freude und voller Schmerz – und das alles vor dem Hintergrund der Siebzigerjahre. Und es sind Siebzigerjahre, in die man sich gerne hineinwünscht, weil sie von coolen Klamotten, cooler Musik und – vor allem! – unbegrenzten Möglichkeiten geprägt sind. Gary ist einer, der diese Möglichkeiten am Schopfe packt. In einem Laden entdeckt er den letzten Schrei auf dem Einrichtungsmarkt, ein sogenanntes Wasserbett . Kurz später hat er ein gut laufendes Wasserbetten-Business am Start. Als die Ölkrise die Produktion von Wasserbetten verteuert, steigt er aus und stampft über Nacht eine Spielhalle aus dem Boden, weil just in diesem Augenblick die Flipper-Automaten legalisiert werden. Und zwischendurch rennt er zu Castings, um den Anschluss an die Schauspielerei nicht zu verlieren. Ein Mann (Junge!) der Tat eben. Alana zieht er dabei immer schön mit. Mangels Alternativen lässt sie das auch gerne mit sich geschehen. Sogar die Schauspielerei will sie ausprobieren. Es ist eine geradezu unermessliche Freude, Gary und Alana bei allem zuzusehen, was sie eben so tun. Ob sie sich nun annähern oder miteinander streiten, ob sie herumalbern oder arbeiten. Alles ist irgendwie toll und alles ist irgendwie frisch. Auch weil es sich so fundamental von der Welt der Erwachsenen abhebt. Weder der Teenager noch die Mittzwanzigerin gehören zu dieser Erwachsenenwelt, auch wenn sie beide auf ihre jeweils eigene Weise immer wieder darin eintauchen. Dabei begegnen sie dann Typen wie dem Schauspieler Jack Holden (Sean Penn) und seinem Kumpel Rex Blau (Tom Waits), die beide krampfhaft versuchen zu beweisen, dass sie ihre besten Jahre nicht weit hinter sich gelassen haben. Oder Jon Peters (Bradley Cooper), dem Freund von Barbra Streisand, der nicht nur ziemlich cholerisch ist, sondern seine Finger partout nicht von allen weiblichen Wesen in seiner Nähe lassen kann. Es ist Paul Thomas Anderson hoch anzurechnen, dass er die großen Stars in Licorice Pizza die Hampelmänner geben lässt, während die Bühne wahrer Schauspielkunst den Jungen gehört, allen voran natürlich Cooper Hoffman und Alana Haim. Und diese Jungen sind ja keine vollkommen Unbekannten. Alana Haim ist Teil der Band Haim – zusammen mit ihren beiden Schwestern Danielle und Este (die auch im Film ihre Schwestern spielen dürfen, und weil man Familien nicht trennen soll, spielen die Eltern Haim gleich ebenfalls mit). Cooper Hoffman ist sozusagen qua Geburt berühmt, denn er ist der Sohn des 2013 verstorbenen Schauspielers Philipp Seymour Hoffman. Die beiden machen ihre Sache mehr als gut und spielen gründlich und unmissverständlich jeden Zweifel weg, sie könnten nicht wegen ihres Talents und ihrer Authentizität vor der Kamera stehen, sondern aufgrund der Tatsache, dass sie eine bekannte Sängerin und ein berühmter Sohn sind. Außerdem tragen sie durch ihr perfektes Nicht-Perfektsein ganz grandios dazu bei, das Flair der 70er lebendig werden zu lassen, in denen eben auch nicht alles so glatt und perfekt war wie in Zeiten von Instagram und Photoshop. (Dieser Eindruck wird auch dadurch unterstützt, dass der Film analog gedreht wurde und so ein wenig körnig daherkommt.) Manchmal braucht es eben nur einen schiefen Frontzahn, um einen Menschen sich von der Masse abheben und so richtig schön sein zu lassen. Ob ich verliebt in die beiden Hauptfiguren bin? Aber selbstverständlich! Und ich gehe mal davon aus, dass ich damit nicht alleine dastehe. Ah, der Vollständigkeit halber, weil diese Frage natürlich unausweichlich ist: Was bedeutet dieser sonderbare Titel eigentlich? Licorice Pizza – Lakritzepizza . Nun, dieses Rätsel ist leicht aufzulösen. Dahinter verbirgt sich eine umgangssprachliche Bezeichnung für eine Langspielplatte. 70er eben!

Billy Summers ist ein netter Typ. Einer, den man gerne als Nachbarn hat. Weil er seinen Rasen pflegt und auf diese Weise zum guten Erscheinungsbild der Wohngegend beiträgt. Weil er mit den Nachbarskindern Monopoly spielt. Weil er immer für einen spontanen Grillabend zu haben ist und herzhaft zugreift, wenn jemand selbstgebackene Kekse anbietet. Billy Summers ist nebenbei ein Auftragskiller, und zwar ein ziemlich guter. Doch das braucht niemand zu wissen. Zumindest vorerst. Später ist es egal. Denn der bevorstehende Mord wird sein letzter sein. Mit den zwei Millionen Dollar, die er dabei verdient, kann er sich beruhigt zur Ruhe setzen. Eine neue Identität hat er schon vorbereitet. Billy Summers wird es dann nicht mehr geben. Eigentlich kann nichts schiefgehen. Denn Billy Summers ist nicht nur nett und gut in seinem Job, sondern auch sehr gründlich und akribisch. Aber wie das so ist ‒ und weil ein Roman natürlich danach schreit ‒ geht trotzdem etwas schief. Nicht alles, aber genug, um die Geschichte in eine unerwartete Richtung zu drehen. Mit großer Erzähl- und Detailfreude lässt Stephen King uns in der ersten Hälfte des Romans an Billy Summers’ Leben und der Planung seines letzten Mordes teilhaben. Das liest sich nicht nur sehr unterhaltsam, sondern auch intensiv. Das liegt zum Teil natürlich daran, dass die Planung eines Scharfschützen-Mordes eine interessante Sache ist. Mindestens genauso verantwortlich dafür ist aber die Tatsache, dass die Geschichte zum Gutteil vom Schreiben handelt. Denn als Tarnung haben sich die Mittelsmänner, die Billy Summers den Auftrag verschafft haben, darauf geeinigt, Billy als Schriftsteller auszugeben. Was anfangs als reine Tarnung gedacht war, wird mehr und mehr zu Billys Leidenschaft. Er will schreiben. Allmählich wird dies sogar noch wichtiger als die zwei Millionen Dollar, die man ihm für den Auftragsmord versprochen hat. Stephen King hat in einem Interview einmal gesagt, er kenne sich vor allem mit zwei Dingen aus: mit der Angst und mit dem Schreiben. Das mit der Angst hat er uns ja in unzähligen Romanen hinreichend vorgeführt, die ihn zum anerkannten „Meister des Horrors“ haben werden lassen. Oft genug hat er das Schreiben und die Angst dabei in Verbindung miteinander gebracht, man denke etwa an Shining oder Sie (das unter dem Originaltitel Misery verfilmt wurde). In Billy Summers wird man vergeblich nach den klassischen Horrorelementen suchen. Es gibt nichts Übersinnliches, keine Mörderclowns oder menschenfressende Nebelwolken. Wenn überhaupt, begegnet uns der Horror in seiner banalsten Form, in dem nämlich, was Menschen einander nunmal antun, im Krieg wie auch im normalen Leben. Ums Schreiben geht es dafür umso mehr. Mit lesbarer Freude und Genugtuung beschreibt Stephen King, wie seine Hauptfigur dem Sog dieser Tätigkeit immer weniger widerstehen kann (und will) und wie sich eine Niederschrift plötzlich in ein Buch, in einen Roman verwandelt. Für Billy Summers – das dürfen wir, seine Leser, miterleben – ist das Schreiben eine Konfrontation mit der eigenen Vergangenheit. Die Ordnung der eigenen Geschichte. Die Rechtfertigung seines Handelns und Mordens. Und damit all das, was Schreiben eben so ist. Dies mitzuverfolgen macht Spaß. Auch wenn der Roman in der zweiten Hälfte ein wenig an Spannung und Intensität verliert. Vielleicht hat es damit zu tun, dass Billy Summers‘ Welt aufgebrochen wird. Der professionelle Killer, der sein Leben mit einer durchstrukturierten Akribie geführt hat, die schon fast autistische Züge annimmt, bekommt plötzlich Besuch. Fortan ist er nicht mehr der konsequente Einzelgänger, sondern eine Hälfte eines Duos. Über die zweite Hälfte sei hier aus Gründen des Spannungserhalts nichts verraten – aber wie gesagt, mit Horror hat all dies nichts zu tun. Ungeachtet des kleinen Spannungsabfalls in der zweiten Hälfte des Buchs habe ich jede Seite dieses Romans genossen. Weil er Spaß macht. Und er macht Spaß, weil Stephen King erzählen kann und so unübersehbar Freude an seinen eigenen Figuren, Themen und Geschichten hat. Und ich muss zugeben, dass es seit langer Zeit das erste Buch von Stephen King war, das ich überhaupt in die Hand genommen habe. Ich hatte mich davor schlicht überlesen an ihm, und damit stehe ich sicherlich nicht alleine da, angesichts seines mittlerweile komplett unüberschaubaren Œuvres. Umso schöner, als dieses Buch für mich persönlich einen Kreis schließt. Ich habe Stephen King mit Billy Summers nämlich wiederentdeckt, wie ich ihn mit Es entdeckt habe – anhand des Buchcovers. Damals, vor mehr als dreieinhalb Jahrzehnten, sah ich dieses monströs dicke und große Buch, das mir den Titel in Schwarz auf Knallrot entgegenschrie, im Schaufenster des Schreibwarenladens meines Heimatortes stehen. Ich musste das Buch einfach haben und lesen … und was folgte, war ein jahrelanger Ritt durch das gesamte Horrorspektrum, das Stephen King bis in die späten 80er, frühen 90er vor seiner Leserschaft ausbreitete. Auch diesmal war es das Cover, das meinen Blick anzog – eine eigentlich dezente Farbexplosion, aus der sich ein Frauengesicht, eine Mörderhand und ein paar Gebäude hervorschälen. Das alles im Glanz von Fotopapier gefasst und mit einem leicht abgesetzten Schriftzug des Romantitels versehen. Mehr hat es nicht gebraucht, um mich zugreifen zu lassen. Stephen King? Uh, lange ist’s her – vielleicht sollte ich mal wieder einen Versuch wagen … Ich habe es nicht bereut. Und wer weiß, vielleicht schaue ich ja mal in einen der vielen Romane rein, die ich in den letzten mindestens zwanzig Jahren verpasst habe.

Im Oktober 2021 startet die mittlerweile sechste Staffel unserer zweijährigen Fortbildung. In meiner Werkstatt „Journalistisches Schreiben“ sind noch Plätze frei. Warum sind Plätze frei? Nun, manchmal spricht zwar vieles für eine bestimmte Sache. Manchmal gibt es aber auch ein paar berechtigte Einwände. Berechtigte Einwände sind auch dann berechtigt, wenn man sie entkräften kann. Und nichts ist doch überzeugender, als ein entkräfteter berechtigter Einwand, oder? Gleich geht’s los. Vorher aber noch der Link, wo man sich näher informieren und auch anmelden kann: https://www.lpz-stuttgart.de/angebot/ Übrigens: Auch in den Werkstätten „Szenisches Schreiben“ sowie „Wort & Spiel“ sind noch Plätze frei! Wer noch weitere Fragen hat, darf sich natürlich jederzeit bei mir melden. Ich beantworte gerne alles. Und im Bedarfsfall biete ich auch eine Videoberatung an. So, und nun kommen die berechtigten Einwände: 1. Zwei Jahre sind eine lange Zeit Warum soll ich mir das antun, wo es doch auch 2-tägige Fortbildungen gibt? Weil man in zwei Jahren viel tun und viel ausprobieren kann. Vor allem: man kann sich selbst weiterentwickeln. Die Entwicklung von Fähigkeiten ist – wie man ja auch von der eigenen Arbeit in der Schule weiß – ein Prozess. Und es ist schön, wenn jemand diesen Prozess begleitet. Das erste Jahr gehört ausschließlich dem eigenen Schreiben. Erst dann entscheidet jede*r für sich, wie er*sie all dies in den eigenen Unterricht integriert. 2. Ich habe momentan andere Sorgen als mich fortzubilden. Ganz gewiss. Aber gerade jetzt, da so vieles im Umbruch ist, kann es nicht schaden, sich mit Neuem auseinanderzusetzen. Vielleicht sogar mit Dingen, die ein paar Fragen beantworten und die Arbeit erleichtern, ob im digitalen oder im analogen Zusammenhang. Überdies hat sich gezeigt, dass sowohl die Atmosphäre und Nähe in einer Fortbildungsgruppe als auch der Austausch in schwierigen Zeiten sehr bereichernd und beruhigend sein können. 3. Ich brauche das nicht. Ich mache bei einem „Zeitung in der Schule“-Projekt meiner Lokalzeitung mit. „Zeitung in der Schule“ ist eine schöne Sache. Dieses Programm legt den Schwerpunkt aber meist auf das Rezipieren und das Einordnen von Zeitungstexten. In unserer Fortbildung geht es um mehr. Es geht um die Nutzung journalistischer Methoden und Formen, um eigene Themen zu transportieren, um die eigene Sprache und Persönlichkeit zu entwickeln und damit nicht nur Zeitungswissen, sondern journalistische und Medienkompetenz aufzubauen. Wir beschäftigen uns außerdem nicht nur mit Zeitungsformen, und zwar ganz praktisch, sondern auch mit anderen Medienformen wie Fotografie und Podcast. 4. Eine Fortbildung für Lehrkräfte ALLER weiterführender Schulen? Gymnasium und Förderschule in einem Raum? Kann so etwas funktionieren? Das funktioniert sehr gut. Denn unser Gegenstand verändert sich nicht, nur weil wir es mit einer anderen Schulart zu tun haben. Unterschiedlich sind nur die Methoden, die schließlich angewendet werden, wenn es darum geht, das in der Fortbildung Gelernte im eigenen Schulalltag umzusetzen. Und da ist es mehr als nützlich, auf die Erfahrungen und auf die Ideen von Kolleg*innen zugreifen zu können, die an der gleichen Sache arbeiten. Übrigens wird es immer als sehr bereichernd empfunden, die eigenen Methoden und die Ergebnisse der Schüler*innen noch einmal vergleichen und damit vielleicht besser einschätzen zu können, wenn man sich in der Gruppe austauscht. 5. Es könnte ja sein, dass die Fortbildung gar nicht so gut ist. Das ist sie aber. Und zwar sehr gut. Sie ist darüber hinaus bereichernd und macht einen Heidenspaß. Zugegeben, ein bisschen Aufwand bedeutet das alles schon. Aber der lohnt sich. Versprochen!

Diese Veranstaltung war bereits ein Erfolg, bevor sie begonnen hat. Und zwar schlicht deshalb, weil sie überhaupt stattfand. Das ist in diesen Zeiten keine Selbstverständlichkeit. Lange sah es so aus, als ob wir die Werkstatt auf unbestimmte Zeit verschieben oder gar ganz ausfallen lassen müssten. Dann der Entschluss: Wir ziehen’s durch, mit eiserner Corona-Regel-Disziplin.

Zweieinhalb Monate ist mein erster Besuch in Prag nun her. In der ersten Weltenschreiber-Werkstatt hier haben wir – der Lehrer Ondřej Špaček vom Thomas Mann Gymnasium, die Schüler*innen und ich – uns mit literarischen Kurzübungen sowie mit der Planung unserer weiteren Arbeit beschäftigt. Die Entscheidung der Gruppe lautete damals: Wir wollen einen Roman schreiben. Aber einen, der aus kleinen Einzelteilen besteht, die lose zusammen hängen. Diesen Roman wollten wir nun auf den Weg bringen. Ondřejs und mein Plan: Die Schüler*innen in die Lage versetzen, mit der Arbeit an ihrer jeweiligen Geschichte / ihrem jeweiligen Kapitel zu beginnen. Vielleicht könnten sie während der beiden Tage im Prager Goethe-Institut ja sogar schon mit dem richtigen Schreiben beginnen. Kleine Brötchen. Das war unsere Devise. Lieber nicht zu viel auf einmal verlangen. Die Sache soll ja Spaß machen und niemanden unter Druck setzen. Entsprechend haben wir am ersten Tag vorsichtig begonnen. Mit einer kleinen Schreibübung. Mit einer Auffrischung dessen, was bislang diskutiert worden war. Mit einer gemeinsamen Runde, in der die Ideen für die einzelnen Geschichten besprochen und erste Verbindungsmöglichkeiten zwischen diesen Geschichten ausgelotet wurden. Die Ideen waren sehr vielversprechend. Aber als wir dann langsam vorfühlten, wie denn die Einzelgeschichten zusammenhängen könnten, herrschte ein wenig Ratlosigkeit. Wohlwollende Ratlosigkeit. Die Art von Ratlosigkeit, die in einer Schreibwerkstatt manchmal herrscht und in der die Teilnehmer*innen mit Gesichtern dasitzen, die stumm, aber sehr deutlich sprechen: Wir hören Sie, Herr Rau, wir wollen uns auch gerne auf alle Experimente einlassen, die Sie da vorschlagen. Aber wir haben nicht die geringste Ahnung, wovon Sie gerade sprechen. Ondřej und ich taten unser Bestes, um Optimismus zu verbreiten. Das wird schon. Sobald die Ideen Text werden und wir über Konkretes sprechen, ergibt sich auch eine Vorstellung von Zusammenhängen.

Für die meisten der neun Jugendlichen war es das erste Mal, dass sie selbstgeschriebene Texte bei einer Veranstaltung vorgelesen haben. Insofern war der heutige Tag für sie gleich doppelt aufregend. Denn ein bisschen nervös ist man ja immer vor einer Lesung. Wenn man aber noch nicht weiß, wie sich das anfühlt, mit einem Gedicht oder mit einer Kurzgeschichte vor erwartungsvollen Gesichtern zu stehen, dann kann aus der Nervosität helle Aufregung werden. Aber am Ende konnten alle sagen: Alle Mühen haben sich gelohnt.
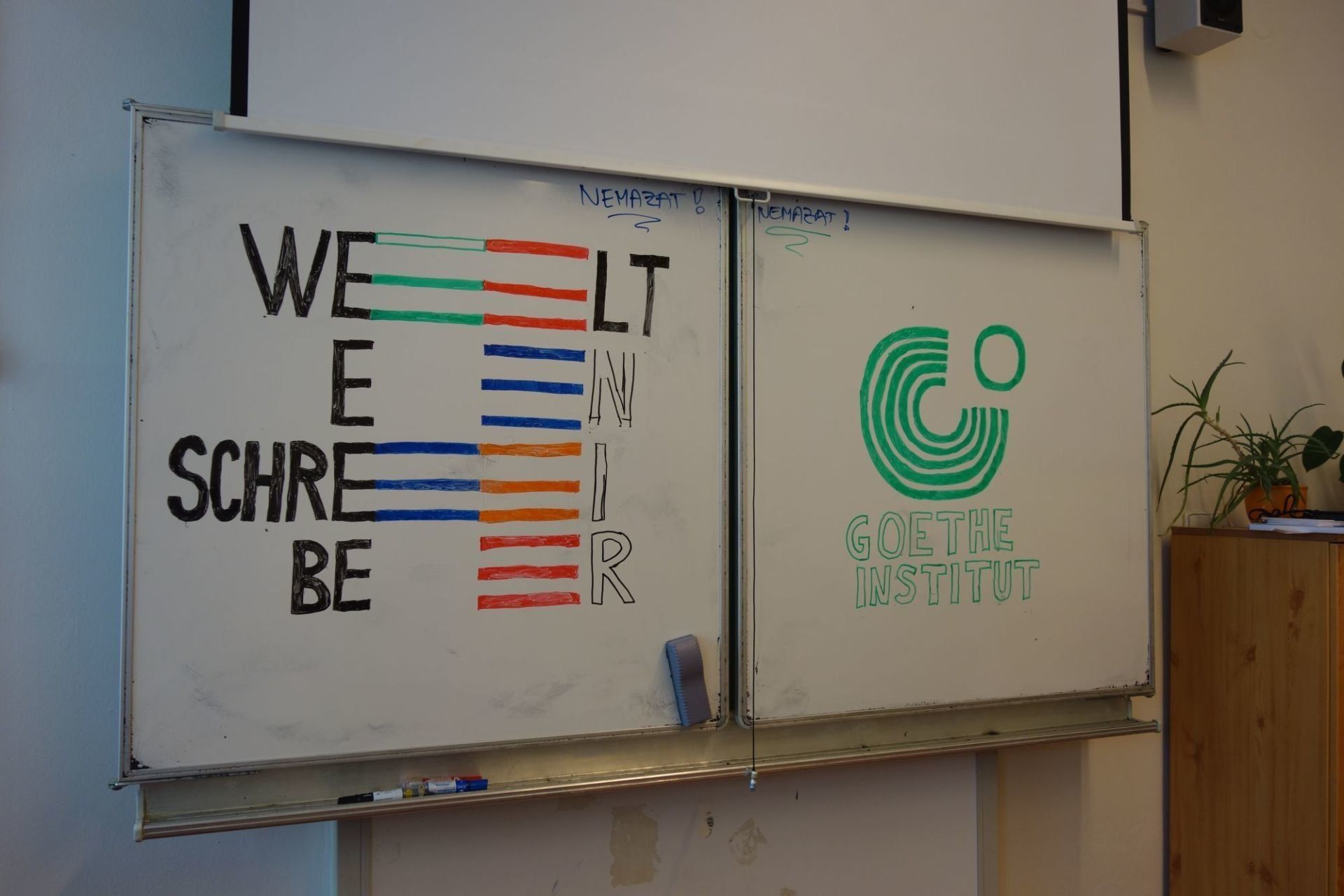
Wenn das Klassenzimmer für die Lesung vorbereitet wird, dann richtig. Mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln (Farben) haben die Schülerinnen und Schüler die beiden Logos an die Tafel gemalt. Gelb war leider alle - oder nie vorhanden. Trotzdem sind die "Weltenschreiber"- und "Goethe-Institut"-Logos ziemlich gut gelungen. Diese kleine Tafelkunst war aber nur ein kleiner Exkurs am heutigen Tag, wenn auch einer, der den Beteiligten großen Spaß gemacht hat. Und sie haben alles gegeben, um die Proportionen der Originale beizubehalten. Ansonsten stand der heutige letzte Werkstatttag ganz im Zeichen des Übens und des Herrichtens. Die Texte, die beim morgigen "Open House" des Prager Thomas-Mann-Gymnasiums vorgelesen werden, wurden ausgewählt, noch einmal lektoriert und dann einstudiert. Jetzt sitzt alles! Alle wissen, an welchem Punkt sie an der Reihe sind und wie sie ihren Text am besten zur Geltung bringen.


